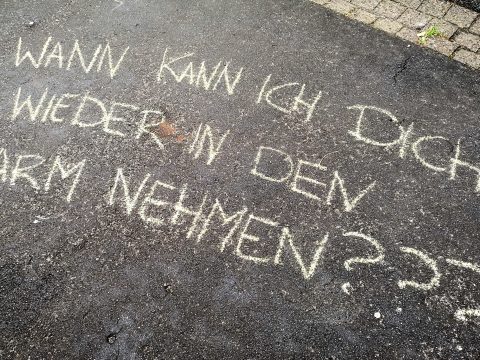Nach der Oper „Anthropocene – Die Frau aus dem Eis“ begibt sich das Theater Bielefeld mit der spartenübergreifenden Produktion “Moby Dick” zum zweiten Mal in dieser Spielzeit auf hohe See. Franziska Eisele und Michael Heicks haben eine Bühnenfassung des Romans von Hermann Melville erstellt und zur Premiere gebracht. Gezeigt wird ein Spektakel der besonderen Art.
Die turbulente Mischung aus Tanz, Schauspiel, Musik und Video, die Regisseur Michael Heicks und Choreograf Gianni Cuccaro zusammen mit Oliver Baierl, Simon Heinle, Christina Huckle, Stefan Imholz, Nicole Lippold, Susanne Schieffer, Alexander Stürmer, Thomas Wolff, Faris Yüzbasioglu, Tommaso Balbo, Carla Bonsoms i Barra, Hampus Larsson, Andrea Martin, Laura Martin Rey, Noriko Nishidate, Alexandre Nodari, Ana Torre, Andrea Zinnato auf die Bühne gebracht haben, überzeugt auf der ganzen Linie.
Schon allein vor der Tatsache, dass der 1000-Seiten-Roman auf einleuchtende zwei Stunden eingedampft wurde, muss man den Hut ziehen. Natürlich könnte man beckmessern: dies fehlt, da ist zu wenig und überhaupt… Aber der Versuch, die Monströsität des Autokraten Ahab einerseits und die schier nicht zu bewältigende Textmenge um Seefahrt, Walfang und die philosophische Dimension der Farbe Weiß – denn Moby Dick ist der weiße Wal schlechthin – in einen Theatertext zu fassen, das muss man sich erst mal trauen.
An Bord eines Seelenfängers
„Nennt mich Ismael“ – mit diesem berühmten Satz beginnt auch bei Heicks das Drama eines Jungen aus gutem Hause, der zur See fahren will. Er erzählt von seiner Sehnsucht zur See zu fahren, die natürlich naiv ist. Und bekommt dann erst mal einen Schreck, als er erfährt, auf welchem Seelenfänger er da angeheuert hat. Schon der sprechende Name des Schiffes, Pequod, deutet auf den Untergang hin. Denn Pequod ist der Name eines Indianerstammes, der 1637 durch Engländer ausgerottet wurde. Aber ein Zurück gibt’s nicht. Die Faszination der Freiheit der Meere… Eine verhängnisvolle Illusion!
Lange bevor Kapitän Ahab auftritt, weiß dann auch das Publikum, dass dieser Ahab ein Mensch ist, der sich geschworen hat, den Wal, der ihm ein Bein abgebissen hat, zu jagen und zu erledigen. Und dass er auf absolutem Gehorsam besteht. Natürlich hat Ahab einen Gegenspieler. Das ist der gläubige Steuermann Starbuck, der vor Ahabs Wut und Unbeherrschtheit immer wieder warnt. Der es aber auch nicht mit seinem Glauben und dem Vertrag, den er mit Ahab geschlossen hat, verantworten kann, das Schiff zu verlassen.
Diesen Moby Dick auf die Bühne zu bringen, war ein lang gehegter Wunsch von Regisseur Michael Heicks. Zur Realisierung braucht man halt auch die Voraussetzungen dazu. Hier und nun waren sie gegeben. Besonders gelungen sind zwei Tanzszenen, in denen das gesamte Ensemble einmal gegen die Urgewalt des Wassers antanzt, nein: ankämpft, und beim zweiten Mal sich Ahab und dem von ihm geforderten unbedingten Gehorsam unterwirft.
Der Kampf gegen Urgewalten
Die gewaltige Kraft des Wassers wird eimerweise in hohem Bogen von den Seitenbühnen herein geschleudert, Ventilatoren erzeugen Wind, die „Kapelle“ spielt dramatische Musik: Jean Jacobi, Patrick Reerink, Lauenz Wannenmacher und Reinhold Westerheide verstehen es, das Gewusel auf der Bühne – alle Akteure kämpfen gegen den Sturm stürzen, fallen, stolpern, laufen, holen dabei abwechselnd und durcheinander rennend die bereitgestellten und immer wieder mit Wasser gefüllten Eimer, um sie in hohem Bogen auf das Deck und über die Akteure zu stürzen – musikalisch ganz hervorragend zu unterstützen. Schillers „Alles rennet, rettet flüchtet,/ taghell ist die Nacht gelichtet“ – scheint ein blasser Abklatsch gegen diese Szene. Eines ist aber doch zu bemängeln: die Lautstärke der Musik dürfte ein wenig gedämmt werden. Wunderbar die große Ruhe nach dem Sturm, wenn das Ensemble nun gemeinsam die Wasserflut beseitigt. Auch hier zeigt sich choreografischer Witz. Grandios.
Eindrucksvoll auch die zweite große Tanzszene, in der das Ensemble nach und nach den Gang des mit einem Holzbein versehenen Ahab aufnimmt – die Szene, in der die Besatzung die vollkommene Unterwerfung unter des Kapitäns Willen zeigt.
Nicht ganz so überzeugend dagegen die wenig aufgelockerten Monologe, in denen es u.a. um Ahabs Geschichte oder um die juristischen Unterschiede zwischen Los- und Festfisch geht. Einfallslos stehen die Akteure im Rampenlicht und tragen vor.
Ein besonderes Lob gebührt dem Bühnenbild von Annette Breuer. Man meint, ein Schiff zu sehen, das nicht unbedingt im besten Zustand ist – Stichwort Seelenverkäufer. Das Segelreffen gelingt immer weniger perfekt. Auf der Hinterbühne ist eine große Hohlkehle aufgebaut. Die dient im unteren Teil gern den Akteuren als Rutschbahn. Vor allem aber wird sie gebraucht als Videoprojektionsfläche für Wellen. Durch die große Tiefe wird eine schöne Illusion von Seegang erzeugt. Am Ende des Abends sind Akteure wie Zuschauer erschöpft. Die Akteure aber sicherlich dank ihres unermüdlichen körperlichen Einsatzes erheblich mehr. Der Beifall war nicht enden wollend. Zu recht.
Ein Wort noch zur Überschrift: In einem Brief an Richard Henry Dana Jr., der 1840 ein Buch über seine zweijährige Seefahrt als Matrose veröffentlichte, schrieb Herman Melville sinngemäß, dass er aus Walspeck kaum Poesie herstellen könne. Das „muss nach der Natur der Sache so plump anmuten wie die Hopser und Walzer der Wale selbst. Trotzdem will ich die Sache wahrheitsgetreu darstellen.“